
Ein herzliches Willkommen…
… zu unserem Newsletter, den wir begleitend zum Kinderdokumentarfilm- und VR-Projekt WUNDERKAMMERN gestartet haben
Auch in Ausgabe #3 wollen wir euch Einblicke in unser Projekt geben, das wir gemeinsam mit Joline (12), Roya (12), Wisdom (11) und Elias (14) und noch vielen anderen Kindern entwickelt haben. So ist ein Film und eine VR-Experience entstanden, die andere Kinder einladen soll, von ihren Träumen, Sorgen und Ängsten zu erfahren. Die Kinder sprechen dabei Themen an, die ihre Kindheit in Deutschland prägen: Mobbingerfahrungen, Liebe, das Gefühl, nicht dazuzugehören, Freundschaft, Rassismus. Dabei zeigen sie, dass Verletzlichkeit eigentlich Stärke ist. Und dass hinter den offensichtlichen Oberflächen und Schubladen, in denen wir andere Menschen oft einsortieren, phantastische, spannende Welten schlummern, die entdeckt werden wollen.
Für Newsletter #3 sprachen wir mit Luc-Carolin Ziemann, Kuratorin, Autorin und Filmvermittlerin über die Bildungs- und Vermittlungsarbeit von Dokumentarfilmen AN und FÜR Kinder und Jugendliche. Wir lassen euch „Behind the Scenes“ unseres Drehs im Kraftwerk Mitte in Dresden blicken, unsere Editorin Marion Tuor beantwortet 6 Fragen zum großen Thema Montage, dazu verrät uns Roya ihr Familienrezept für eine persische Linsensuppe. Denn etwas Soul Food können wir alle gebrauchen, in diesem Corona-Winter.
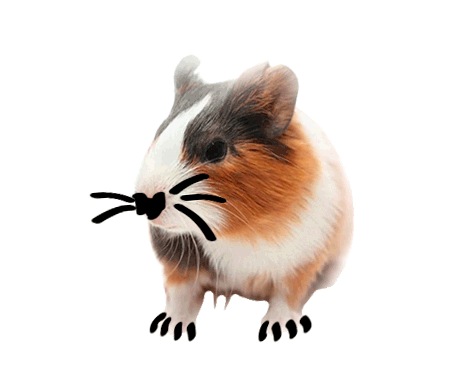


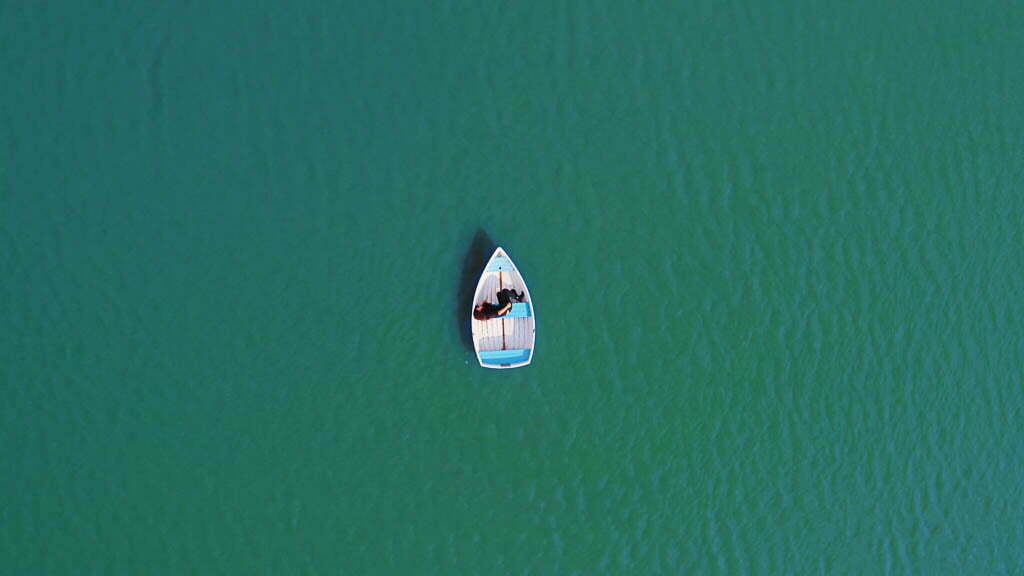
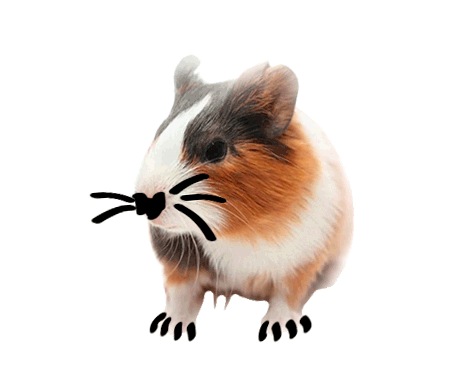




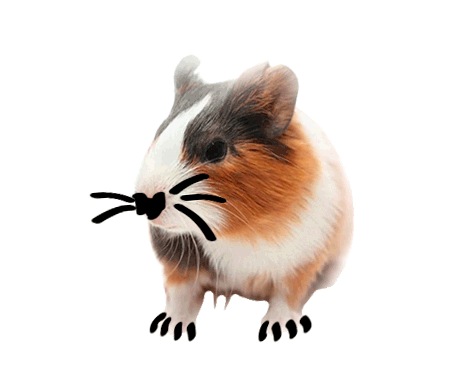

6 Fragen an…
Unter dieser Rubrik wollen wir die erwachsenen Herzen und Köpfen hinter unserem Projekt vorstellen, dieses Mal die Editorin Marion Tuor.
Marion studierte Montage an der „Nationalen Dänischen Filmschule“ und der letzte Spielfilm „Sami, Joe und ich“ den sie geschnitten hat, lief gerade online auf dem Max Ophüls Festival. Mit Susanne Kim hat sie bereits für die Dokumentarfilme „Trockenschwimmen“ und „Die Bande“ zusammengearbeitet, bevor sie gemeinsam in MEINE WUNDERKAMMERN abtauchten. Die meiste Zeit musste der Schnittprozess wegen Corona auf Distanz stattfinden. Aber das ging sehr gut, denn die Beiden kennen sich schon vom „European Film College“ in Ebeltoft, wo sie gemeinsam ein Zimmer und die Care Pakete mit Schweizer Schokolade, die Marions Familie regelmäßig schickte, teilten. Das Gespräch mit ihr findet ihr hier.
Schnitt – da kann man Schere assoziieren, oder eben Scherenschnitt, Hecke im Kleingarten, Frisur, auch Wunde oder eben Film. Es ist aber auf alle Fälle formgebend, (ab)-trennend. Ist Schnitt also irgendwo auch brutal?
So empfinde ich das nicht. Schnitt baut eine Erzählung auf, lenkt den Blick und das Gefühl. Vielleicht ist ein einzelner Schnitt auch mal brutal, aber für mich steht das (Er)schaffen im Vordergrund.
Was ist das Faszinierendste und was ist das Nervtötendste beim Prozess des Schneidens eines Filmes?
Das Faszinierendste ist für mich, das aus verschiedenen filmischen Teilen etwas entsteht, das viel größer ist als die Summe der Teile. Das Nervtötendste eigentlich nur, dass es alles am Computer sitzend passiert. Ich also immer drinnen sitze.
Musst du als Editorin eigentlich eine gute Psychologin sein?
Ja. Die EditorIn ist PartnerIn im Schaffensprozess der Regie. Da gibt es einige Hochs und auch Tiefs, durch die man die RegiesseurIn begleitet. Man braucht z.B. ein Gespür dafür, wann und wie man die Stärken des Materials hervorhebt und wann und wie man die Schwächen benennt.
Wie war es für dich als Erwachsene einen Kinderfilm zu schneiden?
Das war toll! Am spannendsten war für mich, verschiedene Fassungen Kindern zu zeigen und ihr Feedback zu hören. Ich hatte ehrlich gesagt vorher unterschätzt, wie genau und klug Kinder Filme sehen und kommentieren können.
Hast du eine Lieblingssequenz in „Meine Wunderkammern“?
Darf ich mehrere nennen? Wisdom mit den Stinkbomben hat viel Spaß gemacht zu schneiden und Jolines Käferkampf. Und die Szenen mit Elias auf seinem Planeten sind auch richtig schön geworden, finde ich. Sie sind fast ein wenig Science-Fiction, mit dieser unwirklichen Landschaft.
Welchen Filmstoff würdest du gerne noch mal „neu“ schneiden, als deine Version?
Bei „Herr der Ringe“ würde ich diese gefühlt tausenden Anreden – „Frodo!“ „Sam!“-, rausschneiden! Es ist sowieso oft absurd, wenn sich Filmcharaktere permanent mit Namen ansprechen.
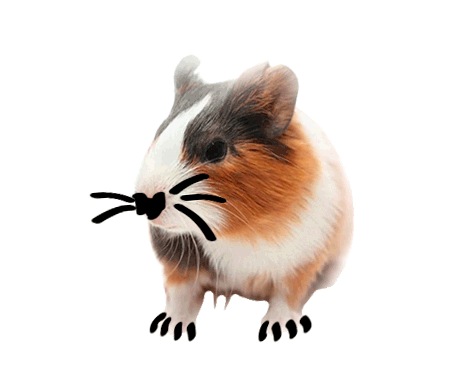

In Zeiten der geschlossenen Kinos und nur Online stattfindender Festivals trafen sich Luc-Carolin Ziemann und Susanne Kim ebenfalls digital, um über Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit Dokumentarfilmen für Kinder und Jugendliche zu sprechen. Luc-Carolin ist Kuratorin, Autorin und Filmvermittlerin. Sie schreibt u.a. für Bildungsplattformen wie kinofenster.de und die Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch für das Goethe-Institut und verschiedene Filmmagazine. Seit 1997 arbeitet sie als Kuratorin und Leiterin der Sektion DOK Bildung für das „Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm“. Seit 2017 ist sie dort auch Mitglied in der Auswahlkommission. Als Filmvermittlerin gibt sie Seminare und Workshops für SchülerInnen und LehrerInnen und schreibt pädagogische Begleitmaterialien zu den verschiedensten Filmen. Sie möchte möglichst viele LehrerInnen vom Einsatz von Filmen im Unterricht begeistern und wünscht sich viel mehr anspruchsvolle Kinderfilme in Deutschland.
Wie muss man sich deine Arbeit als Vermittlerin von Filmen eigentlich vorstellen?
Ich bin eher nicht diejenige, die hochmotiviert vorne steht und behauptet, dass ist ein ganz toller Film, sondern vielmehr fragt, wie hat es euch denn gefallen? Wenn ich Filmvermittlung betreibe, geht es mir grundsätzlich eher darum zu erfahren, was mein Gegenüber wahrgenommen hat, als ihm zu erklären, wie ich den Film wahrgenommen habe. Meist arbeite ich mit SchülerInnen ab 10 Jahren aufwärts, das ist meine Zielgruppe. Da geht es auch immer um die Dualität, einerseits weiter ins Thema des Filmes einsteigen zu können, aber auch zu gucken, wie arbeitet dieser Film filmsprachlich, wie schafft er es, einen auf die Art zu berühren, wie er es tut. Warum kann er mich fesseln und woran könnte es liegen, dass ich an bestimmten Stellen abschweife? Auch wenn ich mit LehrerInnen im Rahmen von Fortbildungen arbeite, versuche ich mitzugeben, dass die große Chance bei Arbeit mit Filmen immer darin liegt, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Und damit die frontale Bildungssituation und den Expertenstatuts, den LehrerInnen natürlich erst mal haben, aufzugeben. Eher nach dem Motto, ich begebe mich mit euch auf den Platz gegenüber der Leinwand und wir finden gemeinsam etwas heraus.
Wie schätzt du das ein, welche (Vor)-Erfahrungen haben Kinder generell mit Dokumentarfilmen und was interessiert sie an dokumentarischen Filmen?
Es ist ganz schwierig zu generalisieren, gerade bei der heutigen Mediennutzung. Es gibt Kinder und Jugendliche, die sehr unreglementiert ganz viel Zeit vor was auch immer verbringen und es gibt Andere, bei denen die Eltern eine klare Vorauswahl treffen und damit auch stark vorgeben, was gesehen wird.
Ich arbeite oft mit Dokumentarfilmen, die eigentlich gar nicht speziell für Kinder oder Jugendliche gemacht sind, die einen hohen künstlerischen Anspruch haben, die also durchaus herausfordernd sind für Kinder und ein jugendliches Publikum. Man muss sich konzentrieren, wenn man sie in ihrer Gänze wahrnehmen will. Da haben wir schon die erste Hürde. Denn Kinder sind es heute gewohnt, Filme überall sonst zu sehen, als im Kino. Die gucken Filme am Rechner und sogar gerne auf dem Handy. Das ist schön bequem, man kann sich ins Bett kuscheln. Dass Kinder und Jugendliche viel Zeit auf youtube verbringen, weiß wohl inzwischen jeder. Da wird oft eine bestimmte Ansprachehaltung und auch eine spezielle Sprache verwendet, die einem förmlich ins Gesicht springt. Aber um eine Info zu kriegen oder sich unterhalten zu lassen, ist das für Kinder und Jugendliche eine ganz normale Art des Mediengebrauchs.
Die spannende Frage ist, denken sie auch, dass sie da einen Dokumentarfilm vor sich haben, wenn sie einen klassischen Youtuber-Film sehen? Ich glaube aber, kaum ein Jugendlicher denkt, dass das ein dokumentarisches Herangehen an Wirklichkeit ist. Viele Erwachsene glauben, dass die Grenzen stark verschwimmen, apropos Fake News etc. Ich denke, dass Kinder sehr „alert“ sind, was den Umgang mit Realität und Authentizität betrifft. Für Kinder und Jugendliche ist das prinzipiell eine große Frage: werde ich hier beeinflusst oder nicht? Da sind sie meiner Erfahrung nach oft wesentlich bedachter als LehrerInnen oder die Eltern glauben.
Aber dann noch mal provokativ gefragt: würden Kinder oder Jugendliche freiwillig in einen Dokumentarfilm ins Kino gehen?
Ich denke schon, aber tatsächlich ist das Kino nur ein Abspielort unter ganz vielen. Bevor Kinder ins Kino gehen, müssen sie ja längere Wege überwinden und Geld bezahlen. Und das entscheiden dann meist die Eltern. Wir müssen uns eingestehen, dass das Rezipieren eines Filmes im Kino längst nicht mehr der klassische Weg ist, auf dem Kinder und Jugendliche einen Film gucken. Denn die allermeisten Filme sehen sie eben nicht im Kino, sondern zu Hause – und nicht nur, weil wegen Corona die Kinos geschlossen sind.
Wenn ich also sage, es gibt gute Gründe dafür, einen Film im Kino zu erleben – und es gibt natürlich verdammt gute Gründe dafür, – , dann muss ich mich fragen, wie bekomme ich Familien oder Jugendliche mit ihren FreundInnen dazu, eine aus ihrer Sicht ungewöhnlich hohen Aufwand zu betreiben? In einer Zeit, in der man es gewohnt ist, alles zu jeder Zeit haben zu können und oft auch noch umsonst. Sitzen Kinder und Jugendliche erstmal im Kino, dann ist meine Erfahrung, dass sie sich sehr wohl auf ästhetisch spannende, komplexe Dokumentarfilme einlassen. Das Problem ist nur, wie kriege ich sie da hin? Für die Schulklassen, mit denen ich viel arbeite, ist es ja eine relative Zwangssituation, auch wenn das jetzt hart klingt. Die Lehrerin hat entschieden, mit der Schulklasse in den Film zu gehen. Zum Glück kommen sie aber meistens alle raus und sagen, das war jetzt aber total spannend.
Ist der Bildungsbereich dann der einzige Raum, in dem man Kindern und Jugendlichen noch Dokumentarfilme auf großer Leinwand regelmäßig vermitteln kann?
Es ist sicher nicht der einzige Raum, aber relativ häufig der erste Moment, in dem Kinder oder Jugendliche diese erste Erfahrung mit einem Film machen der anders ist, als – sagen wir – die „Känguru Chroniken“ oder „Bibi und Tina“, also das was man eben normalerweise so im Kino guckt. Deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass Menschen diese erste andere Kinoerfahrung machen und einen Fuß in eine andere Art von Kino setzen. Also nicht nur ein Cineplex besuchen, sondern in ein Kommunales Kino, ein Art-House-Kino gehen. Vielleicht liege ich da falsch, ich habe auch keine empirischen Daten, aber ich mache die Erfahrung, dass wenn ich eine Schulvorführung beispielsweise in der Cinemathéque Leipzig mache, von 25 SchülerInnen, 24 da noch nie waren. Weil es nicht das Kino ist, wo sie normalerweise hingehen. Aber es ist total hilfreich, dass sie diesen Ort nach der Schulvorstellung auf ihre innere Landkarte aufgenommen haben. Dann gehen sie auch wieder hin.
Deine Frage zielt ja aber auch darauf ab, was müssen FilmemacherInnen tun, damit Kinder und Jugendliche sich ihre Filme angucken? Ich sage: auf keinen Fall muss man sich an den Mainstream anpassen. Das ist nicht die Hürde, Mainstream gibt es schon genug. Die spannende Frage ist eher, wie nehme ich meinen Film und stelle die Kommunikation, die Verbindung her zum Zielpublikum. Das sind letztlich Marketingüberlegungen. Zu fragen, wie kann ich das Publikum erreichen?
Die Frage ist aber auch, wie kann ich Kinder von spannenden Spielarten des Dokumentarischen überhaupt begeistern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Kinder einen Film „für einen Dokfilm ganz gut finden“ und das ist dann das höchste Lob. Weil sie wenige kennen und filmisches Erleben eher an fiktionalen Filmen messen. Wie kann man sich also ein begeistertes neues Publikum für Dokumentarfilm „heranziehen“?
Kinder schätzen es sehr, wenn sie etwas erleben, was jenseits ihrer bisherigen Erfahrung liegt. Und deine Frage ist ja auch, wie kann ich den Film gestalten, dass Kinder daran Spaß haben und da ist ein Spannungsbogen schon elementar. Ein Film von James Benning wird die allerwenigsten Kinder fesseln. Aber Kinder werden neugierig, wenn sich ein Film anders entwickelt, als sie es erwarten, wenn mal kein fetter Kommentar darüber liegt, oder Musik, die sie förmlich zwingt, bestimmte Gefühle zu entwickeln. Kinder mögen es, nicht die ganze Zeit überwältigt zu werden. Auch dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, mit welchen ProtagonistInnen sie sich identifizieren wollen. Auch das ist ja im Mainstream meist total formatiert. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Da ist es schon mal ein guter Ansatz, zu realisieren: das Leben lässt sich nicht in Schwarz und Weiß einteilen und mein Publikum wird divers sein und wird deshalb auch unterschiedliche Vorlieben haben.
Es gibt ja auch den Unterschied von Filmen ÜBER oder FÜR Kinder. Welche Erfahrungen hast du damit in dem Prozess, wenn du Filme für das Festival kuratierst? Welche Blickrichtungen der FilmemacherInnen finden sich da?
In Deutschland hinken wir sehr hinterher. Das ist inzwischen ein Allgemeinplatz, es ändert sich aber auch nicht wirklich. Es gibt im dokumentarischen, aber auch fiktionalen Bereich in Deutschland immer noch verdammt wenige anspruchsvolle Kinderfilme. Wenn man sich nur auf die Dokumentarfilme konzentriert, muss man sagen, es gibt eigentlich gar keine langen Dokumentarfilme für Kinder und über Kinder im deutschen Kino, das sind immer nur Ausnahmen.
Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es sehr schwer ist, eine Balance zu wahren zwischen dem ästhetischen und dramaturgischen Anspruch einer FilmemacherIn und dem Konflikt, der bei Kindern noch viel stärker präsent ist, als bei Erwachsenen – wie weit kann ich als RegisseurIn gehen, was kann und darf ich zeigen, wann kann ich die Kamera an haben, wie beeinflusst der filmische Prozess das Leben dieser Kinder? Wenn man den Film dann rein beobachtend anlegt, gibt es ganz viele Fallstricke. Bei euch war es sicher anders, denn ihr habt von Anfang an mit MEINE WUNDERKAMMERN ein Projekt geplant, in das die Kinder involviert werden. Es war also ganz klar, wir versuchen jetzt nicht drei Wochen mit in einer engen Wohnung rumzuhängen, um alle Konflikte abzubilden. So etwas rutscht dann ganz schnell in ein ausstellendes Format. Ihr habt die Kinder, mit dem, was sie in sich haben in ihren Herzen und Köpfen, zu Wort kommen lassen. Und wenn ihr die Situation dieser Kinder beschreibt, leuchtet ihr nicht jede seltsame Ecke ihres Kinderzimmers aus, sondern sie sprechen und handeln als starke Persönlichkeiten, und gestalten den Film selbst mit. Das ist ein großer Unterschied.
Leider ist es aber meistens andersherum. Wir bekommen ganz viele Filme beim Festival eingereicht, die Kinder in Krisensituationen, z.B. schwierigen familiären Situationen zeigen. Die Kamera spielt dann die „Fly on the Wall“ und der Film wird Zeuge von dramatischen Situationen, bis hin zum emotionalen und tatsächlichen Missbrauch. Die Kamera ist dabei, die bildet das ab. Das finde ich schon bei erwachsenen ProtagonistInnen oft wahnsinnig schwierig, sich in solchen Momenten auf den Standpunkt des Beobachters, der Beobachterin zurückzuziehen. Bei Kindern verbietet sich das für mich komplett. Damit habe ich moralisch einfach ein Problem. Wir sehen viel seltener Filme über Kinder in einem – wenn man so will – „normalen“ kindlichen Alltag. Das finde ich sehr schade. Ich fände es total spannend, mehr davon zu sehen, was im alltäglichen Leben von Kindern passiert, weil sie eben ganz andere Wesen sind und ich das irre interessant finde, da genauer hinzugucken. Ein Grund, warum es diese Filme so selten gibt, liegt aber bestimmt auch in der Filmförderlandschaft, die meint, alles müsse ganz außergewöhnlich sein, damit es überhaupt Sinn macht, einen langen Dokumentarfilm darüber zu drehen.
Unsere Kinder im Film haben auch alle ihr persönlichen Päckchen zu tragen. Es ist auch die Frage im Raum, wie „funktioniert“ ein Kind in unserer Gesellschaft und wann nicht? Ich denke, Kinder mit ihren Befindlichkeiten und Problemen sind immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie leben. Ich wollte aber keine Schublade, kein „Label“ oben drauf setzen, also einen Blickwinkel, unter dem man von vornherein als ZuschauerIn die Kinder betrachtet.
Für mich ist ein Film dann ein guter Film, wenn er mir die Freiheit lässt, selber zu denken. Das hat etwas mit der Offenheit der Person zu tun, die ihn macht. Wenn die Regie nur darauf aus ist, in einem Protagonisten das zu zeigen, was ihn, zum Beispiel als Autisten ausmacht, dann habe ich als ZuschauerIn viel weniger für mich selbst zu entdecken. Wenn ihr euch, wie in eurem Film, für Elias (ein Junge aus „Meine Wunderkammern“, Anmerkung der Redaktion) nicht als Autisten, sondern vor allem als Kind interessiert, dann tauchen automatisch mehrere Facetten von ihm im Film auf. Dann wird ein Film mehrdimensional, so dass es auch passieren kann, dass ich vielleicht einen ganz anderen Film sehe als meine Sitznachbarin im Kino. Ich finde, ein guter Dokumentarfilm reduziert nicht die Komplexität des Lebens auf eine These. Genau das machen aber viele Filme, bei denen schon beim Dreh feststeht, wie sich die ProtagonistInnen und der Film entwickeln sollen. Das, denke ich, finden Kinder und Jugendliche – und nicht nur die – oft anstrengend und langweilig zugleich.
Erkennen Kinder und Jugendliche also die filmischen Mittel, die eingesetzt werden?
Auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber Erwachsene tun das oft auch nicht. Aber was jede*r sofort wahrnimmt ist: Dieser Film gibt mir mehr Raum zum Sehen. Er ist so offen gebaut, dass ich selbst Hinweise im Bild entdecken kann.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mit einer, sagen wir 5. Schulklasse, MEINE WUNDERKAMMERN gekuckt, bin ich mir fast sicher, ginge es im Gespräch zu allererst immer um die ProtagonistInnen. Was ist denn mit denen? Was habe ich überhaupt gesehen? Man nähert sich also den einzelnen Personen im Film. Da kann man dann auch fragen, wie sind sie denn überhaupt ins Bild gesetzt worden? Welche visuellen Elemente ordnet man welchem Kind zu? Und so wird man Stück für Stück dahin kommen, dass man die eigene Erfahrung des Filmes abstrahiert und von der Spannungskurve und den Handelnden im Film zu den filmischen Mitteln kommt. Und dann kann man fragen: WIE genau wurde mir denn etwas erzählt? Im Idealfall hat man die Möglichkeit, noch einmal Ausschnitte unter mehreren Aspekten anzusehen. Um daran gezielt die bewussten künstlerischen Entscheidungen der FilmemacherInnen herauszuarbeiten. Auch um klar zu machen, dass die Kamera nicht zufällig in dieser Situation dabei war. Die meisten Menschen machen sich ja keine Gedanken darüber, dass im filmischen Prozess, auch in einem Dokumentarfilm, immer wieder Situationen hergestellt werden, dass sich für eine Kameraposition entschieden wird, ganz zu schweigen von den Eingriffen während der Montage, der Tongestaltung, der Musik usw.
Im besten Fall hat man bei der pädagogischen Arbeit mit dem Film dann jemanden vom Filmteam dabei, die Regie, die EditorIn, die Kameraperson oder wie in eurem Fall, auch die Person, die die Zeichnungen für die Animationen angefertigt hat. Alle, die daran beteiligt waren, dass der Film so ist wie er ist, sind spannend zu befragen. Denn viele ZuschauerInnen, nicht nur Kinder, vergessen, dass Dokumentarfilme zutiefst durchdachte künstlerische Werke sind.
Was wünschst du dir für den Dokumentarfilm und eben auch das Sehen und Erleben von Dokumentarfilmen in der Zukunft?
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, der Dokumentarfilm ist eine aussterbende Art, denn ich denke, dass Dokumentarfilme eine gesellschaftliche Aufgabe haben, dass sie zwischen Medienberichterstattung und Unterhaltung einen wichtigen Platz einnehmen. Sie machen sich die Mühe, die Dinge in ihrer Komplexität wahrzunehmen und diese nicht zugunsten einer schnell formulierten, klaren Botschaft einzudampfen. Nicht nur aufgrund von Corona sind wir nicht in der Lage, überall hin zu reisen, selbst in der eigenen Stadt bewegen wir uns alle in unseren Blasen. Dokumentarfilm ist eine Form der Welterfahrung, die es ermöglicht, in andere Blasen einzutauchen. Das brauchen wir heute dringender denn je. Dass wir uns konfrontieren mit einer anderen Art des Lebens, einer anderen Art der Weltsicht, einer anderen Art des Urteilens – das kann die tägliche Medienberichterstattung niemals leisten. Und die Blasen erweisen sich ja, wie wir sehen, oft als ausgesprochen hart, wenn sie aufeinander krachen.
Da braucht es die Menschen, die sagen, das interessiert mich so sehr, dass ich bereit bin, nicht nur meinen Blickwinkel in diesen Film einzubringen, sondern das, was ich sehe, so stark wirken zu lassen, dass ich bereit bin, sogar meine eigenen Vorannahmen über Bord zu werfen. Wenn ich eben im Drehprozess realisiere, das war eine völlig falsche Grundannahme, ich habe zu sehr mit meiner Brille gekuckt, die Sache ist viel komplizierter und es dann auch schaffe, diese Einsicht im Film zu transportieren. Für mich sind gute Dokumentarfilme Filme, bei denen der Kopf nach dem Film offener ist als vorher. Zum Beispiel kann euer Film Menschen, die überhaupt keine Berührung mit Kindern haben, vermitteln, dass es lauter kleine Universen gibt, die ganz schön tief sind und die uns viel davon mitgeben können, was nicht nur für deren Leben wichtig ist, sondern auch für unseres.
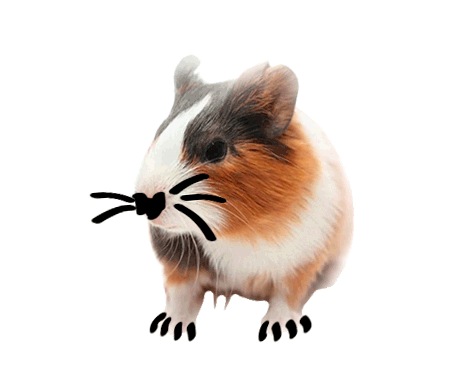
Folgt uns gerne auf Facebook und Instagram, um alles rundum den Film und die VR zu erfahren!
